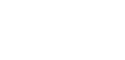Klimafolgenanpassung
Klimafolgenanpassung – Tendenzen für die Gemeinde Loxstedt
Folgen des Klimawandels an der Wesermündung
Klima ist sinngemäß das durchschnittliche Wetter in einer Region.
Im Folgenden sind einige Informationen mit Bezug zu Loxstedt zusammengefasst.
Der Klimawandel mit der Steigerung der globalen Durchschnittstemperatur bedeutet, dass mehr Energie in der Atmosphäre vorhanden sein wird. Die Erwärmung der Atmosphäre, des Bodens und der Temperatur des Meeres führen absehbar nicht einfach zu schönerem Wetter mit mehr Badetagen, sondern auch zu mehr oder stärkeren Extremwetterereignissen und Abweichungen vom Gewohnten bzw. Planbaren.
Ein wärmere Oberflächentemperatur im Meer führt zu einer höheren Verdunstung und irgendwo fällt dieser Regen wieder auf die Erde.
Ebenso führt eine höhere Verdunstung am Boden perspektivisch zu mehr Trockenheit, soweit sie nicht durch mehr Niederschlag ausgeglichen wird. Fällt dieser Regen häufiger in Form von Starkregen, führt das einerseits zu Überschwemmungen, zugleich kann ein ausgetrockneter Boden das Wasser nicht gut aufnehmen, so dass nicht automatisch ein Ausgleich der Wasserverhältnisse in Bodennähe oder im Boden stattfindet. Zudem sind unsere Kulturlandschaften darauf ausgelegt, ein Zuviel an Wasser schnell abzuführen. Immer mehr Flächen sind versiegelt und vermindern so die Grundwasserneubildung. Zugleich erhöhen sie das Risiko von lokalen Überschwemmungs-/ Hochwasserereignissen: Individuelle Betroffenheit ist sofort gegeben, wenn sich das Niederschlagswasser aus dem Vorgarten den Weg in den eigenen Keller sucht.
Die Tendenz der Erwärmung heißt regional aber nicht, dass zweistellige Minusgrade im Winter über den Zeitraum von mehreren Tagen nicht mehr auftreten können. Das begrenzt die Möglichkeiten zum Anbau frostempfindlicher Pflanzen. Außerdem zwingt es - trotzdem die Winter insgesamt wärmer werden – dazu, entsprechend leistungsfähige Heizungen in den Gebäuden verfügbar zu halten.
Die Klimazonen verschieben sich nicht einfach nach Norden, sondern die Bereiche in denen bestimmte Pflanzen und Tierarten sich vermehren können, ändern die Größe und können sich in alle Richtungen verschieben. Wenn dieser Vorgang erdgeschichtlich sehr schnell geschieht, was man derzeit beobachten kann, kann die ortsfeste Flora und Fauna nicht durch Vermehrung mitwandern. Die beweglichen Tiere finden im alten Lebensraum nicht mehr und im neuen noch nicht die notwendigen Lebensbedingungen, gleichzeitig wandern neue Tier- und Pflanzenarten ein.
Wissenschaftlich sind viele diese absehbaren Veränderungen gut erforscht, durch die komplexen Zusammenhänge sind jedoch keine einfachen regionalen Vorhersagen möglich.
Klimawandel in Norddeutschland
Perspektivisch für die Norddeutsche Tiefebene und die Wesermündung sind zunächst die allgemeinen Annahmen für das künftige Klima in Mitteleuropa: Mehr Hitzetage und -nächte im Sommer, mehr Niederschlag, weniger Frosttage und weniger Schnee im Winter.
Zusätzlich ist mit der Lage an der Wesermündung der Meeresspiegelanstieg zu erwarten.
Für das Land Bremen und die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven wurde bereits 2018 eine Klimaanpassungsstrategie erarbeitet. Darin werden die absehbaren Veränderungen des regionalen Klimas beschrieben und Vorsorgemaßnahmen entwickelt. Wesentliche Aussagen der Studie gelten für die gesamte Region. https://www.klimaanpassung.bremen.de
Folgende grundsätzliche Tendenzen werden dort benannt [1]:
- Charakteristisch für das maritim geprägtes Küstenklima sind kühle, niederschlagsreiche Sommer und milde Winter. Die kühlen Sommer und milden Winter werden aufgrund der Nähe zur Nordsee und deren Wärmespeicherkapazität verursacht.
- Durch die Nähe zur Nordsee und die typischen Windverhältnisse entwickeln sich die durchschnittlichen Temperaturen, verglichen mit anderen deutschen Bereichen, z.B. in Süddeutschland, moderater, d.h. die Zunahme der Hitzetage wird geringer ausfallen.
- Für den Zeitraum bis 2050 gilt für die Küstengebiete entlang der Nordsee eine 30 % ige Zunahme der Starkregentage mit Tagessummen von größer als 25 mm Niederschlag als robust (d.h. sicher).
- Die Zukunftsprojektionen weisen nur unwesentliche Änderungen in den jährlichen Niederschlagsmengen auf. Jahreszeitlich bedingt wird angenommen, dass die Herbst- und Winterniederschläge weiter zunehmen und die Sommerniederschläge gegengleich abnehmen.
- Niederschlagsverschiebung und Trockenheit werden in Bremen und Bremerhaven einen spürbaren Einfluss auf den örtlichen Wasserhaushalt haben. Die feuchteren Wintermonate werden, bei gleichzeitig steigenden Temperaturen, zu einem erhöhten Abflussaufkommen der Gewässer führen ( Meeresspiegelanstieg).
- Für Bremerhaven wurde der Meeresspiegelanstieg in den Modellrechnungen bereits berücksichtigt. Hier zeigt sich, dass mit einem weiter ins Land hineinreichenden Einfluss des Seewassers auf das Grundwasser zu rechnen ist. Dabei ist noch nicht klar, wie sich Minima und Maxima der Grundwasserstände entwickeln werden.
- Die aktuellen Klimaprojektionen lassen keine eindeutige Aussage zur zukünftigen Entwicklung der Häufigkeit und Intensität von Sturmereignissen zu.
- Jedoch gilt ein Anstieg des Meeresspiegels in der Zukunft als relativ sicher. Es wird von einem Meeresspiegelanstieg ausgegangen, der bis Ende des Jahrhunderts bei 30 cm bis über einem Meter liegen kann.
- Das Zusammenwirken von höherem Meeresspiegel und Sturmereignissen resultiert in höheren Sturmflutwasserständen. Mittelfristig wird der aktuelle Küstenschutz (bereits geplante Maßnahmen inbegriffen) seine Wirksamkeit behalten.
[1] Die Quelle der Texte und der teilweise wörtlich übernommenen Zitate sind die oben angegebenen. Wegen der besseren Lesbarkeit sind keine Anführungszeichen gesetzt.
Ohne Küstenschutz könnten entsprechend einer Simulation im schlechtesten Szenario Nesse, Loxstedt und Bexhövede bald auf einer kleinen Halbinsel in der Wesermündung liegen. Wie gesagt, ohne Küstenschutz. https://sealevelrise.hcu-hamburg.de/#/
Unterschied Stadt - Land
Andererseits spielen in den verdichteten urbanen Räumen in Bremerhaven die Effekte der Aufheizung der Stadt im Sommer eine zentrale Rolle (Wärmeinseleffekt), anders als sie in der ländlichen Region zwischen den beiden Städten zu erwarten sind. Eine spezielle Stadtklimaanalyse Bremerhaven wurde 2019 erstellt, die schwerpunktmäßig diese Effekte und die erforderlichen Maßnahmen z.B. bei der Stadtplanung beinhaltet. So werden beispielweise Kaltluftaustauschbereiche für Bremerhaven ausgewiesen, die aufgrund ihrer Lage und Charakteristika als besonders wichtig für die großräumige Durchlüftung des Stadtgebiets gesehen werden.
Eine Besonderheit an der Wesermündung ist, dass sich die Norddeutsche Platte entlang einer gedachten Kante von Flensburg nach Rostock senkt. Eine Folge der Eiszeit, als die skandinavischen Gletscher das Land nach unten drückten und es jetzt, wie eine Wippe, wieder aufsteigt. Obwohl das nur ein Millimeter pro Jahr ist, verstärkt es den Effekt.
Dass im Zusammenspiel der Faktoren tatsächlich ein Risiko entsteht, wenn das Zuviel an Niederschlagswasser in der Fläche schlechter abfließen kann, weil die entscheidenden Zentimeter Gefälle fehlen und gleichzeitig Stürme die Weserflut in das Land drücken, ist absehbar.
Der deutsche Klimaforscher und Meteorologe Hans von Storch hat das Bild in der Wanne badender tobender Kinder entworfen, wo ein wenig mehr Wasser nicht zum Überlaufen, wohl aber zum Risiko des häufigeren Überschwappens führt, genauso wie ein heftigeres Toben.
Für die Gemeinde Loxstedt ergab und ergibt sich daraus
- Das Siel- und Pumpwerk Lune hat eine wichtige Funktion für die Landschaft hinter dem Deich.
- Der Deichbau wurde bereits in den letzten Jahren verstärkt.
- Für die besonders niedrigen gelegenen Gebiete und Flächen, in denen Überschwemmungen bei Starkregen aufgetreten sind oder zu erwarten sind, wird die Entwässerungsplanung überarbeitet und bereits Maßnahmen umgesetzt.
- Für den Katastrophenschutz und Freiwilligen Feuerwehren bedeuten Unwetter immer neue Herausforderungen: Ausrüstung und Fähigkeiten müssen dem angepasst werden.
- In der Gemeinde Loxstedt wird einen Prozess zur Anpassung an den Klimawandel begonnen, in dem die Risiken neu bewertet werden, auch bezüglich der Sicherheit der Infrastruktur und der Energieversorgung.
- Für Starkregenereignisse sind mehr Puffer zu errichten, z.B. in Gebäuden Zisternen und Flächen in den Orten, die zeitweise größere Mengen Wasser aufnehmen können.
- Erwärmung und Aufheizung in Gebäuden, besonders in Kitas und Schulen sind zu vermeiden, indem Freiflächen entsprechend gestaltet werden, natürliche Verschattung durch Bäume und bauliche Sonnenschutz genutzt werden aber auch die Farbgebung z.B. der Dächer angepasst werden.
- Für die Böden sollte man Überschwemmungen zulassen, da die mitgeführten Sedimente zur Landneubildung beitragen und ein langsamer Wasserabfluss zu Erhalt des Bodens beiträgt.